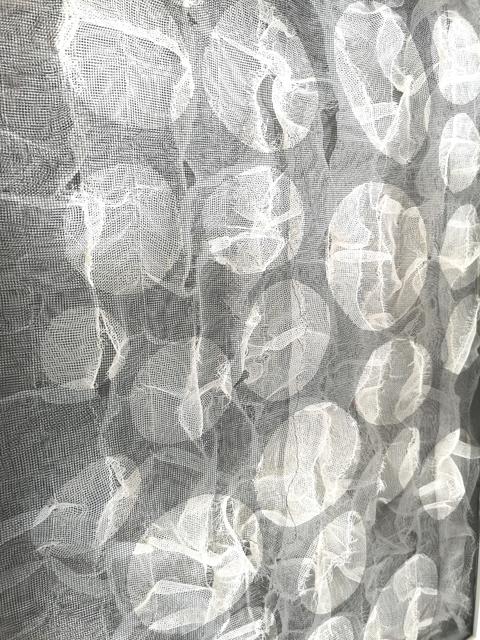75/Paradies/Berichte: Dieter Halama: Von der Hohen Schule ins Paradies
Eine humoristorische Bildungsreise.
„Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 5,1)
„Ich will Euch alle ins Paradies schicken“ (Hl. Franziskus v. Assisi, 2. August 1216)
In der christlichen Heilslehre ist die Aussicht auf ein „ewiges Leben“ im „himmlischen Paradies“ nach dem Ende eines beschwerlichen irdischen Lebens eine der fundamentalen Thesen. Durch den Sündenfall Adams und Evas ist der Mensch des irdischen Paradieses verlustig geworden, dennoch kann er durch eine entsprechende Lebensführung gemäß den biblischen Geboten ins himmlische Paradies gelangen.
Trotz dieser Aussicht versucht der Mensch auch schon während seines irdischen Daseins Lebensräume zu schaffen, die seinen Vorstellungen eines „Paradieses“ entsprechen. Die unterschiedlichen Intentionen und Möglichkeiten der „Schöpfer“, was ein Paradies ausmacht und wie es beschaffen sein soll, lassen verschiedene Varianten entstehen; allen gleich ist jedoch der Wunsch, einen Ort für ein – zumindest zeitweises - Leben frei von Mühsal und Pflicht, Unterdrückung und Angst schaffen zu wollen. Der ursprüngliche Paradiesesgedanke - ein gottgefälliges spirituelles Leben in Frieden und Einklang mit der Natur - tritt zunehmend in den Hintergrund, oder wird überhaupt durch Heiterkeit, Lust, Liebe und materiellen Überfluss ersetzt.
Die folgenden Zeilen behandeln zwei schon lange vergessene „Paradiese“ an den Abhängen des Riederberges im westlichen Wienerwald, nur wenige Kilometer von der heutigen Wiener Stadtgrenze entfernt, die in ihrer individuellen Ausprägung unterschiedlicher nicht hätten sein können: Die „Hohe Schule von Gablitz“ und das ehemalige Franziskanerkloster „Sancta Maria in Paradyso“ am Riederberg. Beiden gemein ist der paradiesische Anspruch: Die fiktive „Hohe Schule von Gablitz“ galt vor allem im 19. Jahrhundert als ein Ort, wo die „heilige Einfalt“ (vulgo Dummheit) uneingeschränkt ausgelebt werden durfte; das spätmittelalterliche in paradiesischer Waldeinsamkeit gelegene Kloster „Sancta Maria in Paradyso“ war hingegen bis zu seinem Untergang im Jahre 1529 ein Ort der franziskanischen Gelehrsamkeit und spirituellen Kontemplation.
Die Hohe Schule von Gablitz
Gablitz ist eine kleine Gemeinde im westlichen Wienerwald, an der Bundesstraße 1 gelegen. Im 19. Jahrhundert war es eine beliebte Sommerfrische der Wiener und berühmt für sein Brauhaus, das erstmals um 1670 erwähnt und 1895 geschlossen wurde. Zeitgenössische Quellen berichten über dessen große Beliebtheit beim Wiener Publikum, die wohl auf eine in Menge und Qualität wahrhaft „paradiesische“ Bierausschank zurückzuführen war.
Seit der Zeit Kaiser Josephs II. „erfreute“ sich der Ort des - durchaus auch als „zweifelhaft“ anzusehenden - Rufes, Sitz der „Hohen Schule von Gablitz“ zu sein. Als Absolventen dieser fiktiven Universität wurden damals diejenigen Menschen bezeichnet, deren „heilige Einfalt“ mit der volkstümlichen Auslegung des eingangs zitierten Satzes aus der Bergpredigt als „Geistesschwäche“ assoziiert wurde. Real hat diese „Hohe Schule von Gablitz“ nie existiert, dennoch wurde sie im 19. Jahrhundert zum „geflügelten Wort“ und die Wienerische Bezeichnung „Gablitzer“ für jemanden, den man nicht direkt mit „Esel“ oder „Hornochse“ ansprechen wollte, wird auch noch in den zu Beginn des 21. Jahrhunderts erschienen Wiener Dialektlexika angeführt. In der realen aktuellen Umgangssprache dürfte der „Gablitzer“ jedoch nicht mehr vorkommen.
Die erste „urkundliche“ Erwähnung der „Hohen Schule von Gablitz“ findet sich im Jahre 1782 in einer kleinen Broschüre mit dem Titel: „Sendschreiben der Ehegemahlin des Herrn Rectoris Magnifici auf der weit und weltberühmten hohen Schule zu Gablitz, an den glorreichen Herrn Author, der neulich den Weibsbildern die Menschheit abgestritten hat, von ihr selbst verfaßt, und publizirt durch Johann Georg Groshaubt, Pedellen an der dortigen hohen Schule.“. Diese war als Antwortschrift auf ein Werk von Michael Ambros mit dem Titel: „Weibsbilder sind keine Menschen, wird Sonnenklar probirt aus der Schrift und aus der gesunden Vernunft.“ erschienen. Die „Ehegemahlin des Rectors Magnifici“ entkräftet in ihrem „Sendschreiben“ Ambros Abhandlung auf derb-humoristische Weise mit dem Hinweis auf die durch übermäßigen Bierkonsum bedingte Hilflosigkeit ihres Gemahls im täglichen Leben. Trotz genauer „Lokalangaben“ über das Gablitzer Wirtshausleben - neben dem Rektor werden hier auch der Gablitzer Kantor und der Schulmeister erwähnt - gibt es keinen realen Bezug zum Orte Gablitz im Wienerwald.
In den folgenden 150 Jahren erschienen zahlreiche Erzählungen, Theaterstücke und Zeitungsartikel humoristischen Inhalts, die auf die „Hohe Schule von Gablitz“ Bezug nahmen. In diesen lässt sich immer wieder eine „satirische“ Verbindung zur Universität Wien nachweisen. So konnte sich im Jahre 1865 nicht nur die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis ihres 500-jähriges Bestehens erinnern, auch in Gablitz soll die Hohe Schule damals, wie das humoristische Wochenblatt „Figaro“ zu berichten wusste, ihr „500-jähriges Jubiläum“ mit einer würdigen Feier begangen haben, deren Höhepunkt die mit den Worten „Es giebt nur eine Wissenschaft — die heilige Einfalt! — vor dir beuge ich die Knie, sancta, simplicitas!“ schließende Festrede des Rektors Thaddäus gebildet hatte.
Die erste Verbindung zwischen den beiden Hochschulen wurde 1785 bekannt. Unter dem Titel: „Auf eine gewisse Feyerlichkeit der hohen Schule zu Gablitz. Durch Joannem Xilangerum, AA. LL. & Phil. Doct. besagter hohen Schule. Gablitz, 1785. In der Universitätsbuchdruckerey.“ kritisiert der bekannte Wiener Autor Johann Baptist Alxinger die Umstände um eine Dekanswahl an der philosophischen Fakultät der Wiener Universität. Der die Ideale der Aufklärung vertretende Autor bezeichnet sich selbst als „Phil. Doctor besagter hohen Schule“, welches den Verfasser einer wenig später erschienen Rezension von Alxingers Schrift zu der Erläuterung veranlasst: „Man sagt hier (in Wien), im Scherze, wenn man jemand nicht geradezu einen Esel heissen will, er sey zu Gabliz promovirt worden.“.
Wenngleich die „Hohe Schule“ erstmals schon 1782 genannt wird, so ist die angebliche Volksmeinung, dass Gablitz „ein Paradies der Dummheit“ sei, noch um einige Jahre älter. In dem vermutlich vom k.k. Hofkapellmeister Florian Gaßmann aus dem Italienischen übersetzten Singspiel „Don Quischott von Mancia“, das im Jahre 1771 in Wien aufgeführt wurde, wird der Ort Gablitz als Ziel einer fiktiven Luftreise der Titelfigur Don Quischott genannt. Eine Anmerkung erläutert: „In dem Italiänischen heißt es Benevento, ein Stadt in Italien. Um also dem comischen Zug nichts zu benehmen, hat der Uebersetzer Gablitz hieher gesetzt.“.
Trotz der zahlreichen Quellen kann die Frage, warum vom Volksmund gerade dem unbedeutenden Wienerwalddorf Gablitz ein „comischer Zug“ und der Sitz einer „Hohen Schule“ zugeschrieben wurden, derzeit nicht genau beantwortet werden. Sie beschäftigte im Laufe der Zeit schon viele Geister. Die ersten diesbezüglichen Nachforschungen im Jahre 1787 schienen zwar noch ernsthaft betrieben worden zu sein, allerdings blieb auch schon damals eine im Gablitzer Brauhaus beim Braumeister durchgeführte Nachfrage ergebnislos. Dennoch stand das Brauhaus stets im Mittelpunkt aller weiteren Deutungsversuche. So war in einem im Jahre 1807 erschienen Reiseführer durch die Umgebungen Wiens als Erklärung für die „Hohe Schule“ zu lesen, im Brauhause zu Gablitz würden die fettesten Ochsen Niederösterreichs gezüchtet. Diese Behauptung ist jedoch ebenfalls, so wie die Hohe Schule selbst, der Phantasie entsprungen, denn die erwähnte Gablitzer Ochsenzucht konnte bisher durch keine einzige „seriöse“ Quelle bestätiget werden.
Eine andere Deutung, die ebenfalls einen Bezug zum Brauhaus liefert, veröffentlichte der Topograph und „vaterländische Schriftsteller“ Franz Xaver Schweickhardt im Jahre 1831: „Dieses Sprichwort soll daher kommen, weil vor vielen Jahren ein Braumeister zwei seiner Söhne durch einen alten Abbé eigens erziehen ließ, welche in einem nächst dem Brauhause auf einer Anhöhe gelegenen Zubauhause wohnten, und allda den Unterricht, leider aber ohne allen Erfolg, erhielten.“.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzählte man sich auch im Ort Gablitz selbst eine weitere „Gründungslegende“, die der Oberlehrer Ferdinand Ramler im Jahre 1911 im Rahmen einer Ortsbeschreibung veröffentlichte: „Nach Angabe alter Gablitzer Bauern sollen de Hochschüler der Forstakademie zu Mariabrunn mit Vorliebe das Brauhaus Gablitz besucht haben. Eines Tages verirrte sich ein Ochse in das Stammlokal der Hochschüler — eine Stube auf der Anhöhe bei der Kühlanlage — und sah zum Fenster heraus, was einen Witzbold veranlaßte, auszurufen: Da seht euch die Hochschule an! Es hieß nun, in der Gablitzer Hochschule schauen die Ochsen zum Fenster heraus.“. Auch diese Geschichte ist nur eine Legende, denn die ehemalige Forstlehranstalt wurde erst im Jahre 1805 in Purkersdorf gegründet und 1813 nach Mariabrunn verlegt, die Geschichte von der Hohen Schule galt hingegen schon im Jahre 1787 als allgemein bekannter „Volksspruch“.
Mit dem durch die zunehmende Motorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg bedingten Verschwinden der Ochsenfuhrwerke aus dem Alltagsleben der Bevölkerung geriet auch der Spruch von der „Hohen Schule“ und den „Gablitzer Studenten“, mit dem der „liebevolle“ Wiener einst zwei- und vierbeinige Ochsen bezeichnet hatte, außer Gebrauch. Dennoch sollte die als „Paradies der Dummheit“ geltende „Hohe Schule von Gablitz“, die übrigens, wenn es sie real gegeben hätte, die älteste Universität Niederösterreichs gewesen wäre, als ein Stück der lokalen Volkskultur nicht der Vergessenheit anheim fallen!
Das Kloster „Sancta Maria in Paradyso“
Verlässt man Gablitz auf der Bundesstraße 1, der ehemaligen „Linzer Reichspoststraße“, in Richtung Westen, so erreicht man nach wenigen Kilometern die Höhe des Riederberges auf dem Wienerwaldkamm, die historische Grenze zwischen den ehemaligen Landesvierteln „ober“ und „unter dem Wiener Walde“, heute Most- und Industrieviertel genannt.
Die von hier sanft ins Tullnerfeld abfallenden Hügel veranlassten schon 1826 den Schriftsteller Johann Hofmann in einem Führer für Pilger nach Maria-Zell zu schreiben: „Man besteigt jetzt den Riederberg; auf dem Gipfel desselben öffnet sich überraschend dem Auge die angenehmste Aussicht in das schöne Rieder Thal. Hier staunt der Pilger, der sich auf seiner Pilgerschaft mehr mit dem Himmlischen beschäftigt, über Gottes schöne Schöpfung und bethet im Staube hingeworfen die Allmacht an.“
Ähnliche Gedanken mögen schon knapp 4 Jahrhunderte früher, zu einem heute unbekannten Zeitpunkt zwischen 1455 und 1464, den Franziskanermönch Gabriel Rangone von Verona dazu veranlasst haben, hier, mitten im Wienerwald, ein Kloster zu gründen und ihm dem Namen „Sancta Maria in Paradyso“ zu geben. Gabriel Rangone war wenige Jahre zuvor, 1451, im Gefolge Johannes von Capistrans, eines Vertreters der Franziskaner-Observanten, die sich streng an das Armutsgelübte des Heiligen Franz von Assisi hielten, von Italien nach Österreich gekommen. Im folgenden Jahr 1452 wurde Gabriel Rangone zum Vikar der neu gegründeten österreichischen Ordensprovinz berufen. In seiner 13-jährigen Amtszeit begründete er, zum Teil in Gemeinschaft mit Capistran, ausgehend vom ersten Franziskaner-Observantenkloster in Österreich, dem Kloster St. Theobald ob der Laimgrube, im heutigen 6. Wiener Gemeindebezirk gelegen, sechs Klöster in Niederösterreich und zwei weitere in der Steiermark.
Zu den Gründungen in Niederösterreich zählt auch das Kloster Sancta Maria in Paradyso. Es wurde zwischen 1455 und 1464 in einem stillen Waldtal am westlichen Abhange des Riederberges an Stelle einer erstmals zu Beginn des 14. Jahrhunderts erwähnten Laurentiuskapelle errichtet. Der Riederberg lag damals noch fernab der großen Hauptstraße von Wien in den Westen, die vermutlich bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts über Mauerbach geführt worden war. In der von Placidus Herzog im Jahre 1740 veröffentlichten Beschreibung der österreichischen Ordensprovinz des Franziskanerordens heißt es, das drei Meilen von Wien entfernte Kloster sei in Folge seiner „lieblichen Lage“ mitten im Walde „im Paradies“ genannt worden. Bei dem hier im Jahre 1464 abgehaltenen Provinzkapitel fasste man sodann auch den Beschluss, das Noviziat und die Schreibschule aus dem Wiener St. Theobaldkloster hierher zu verlegen, „denn es war abgeschieden vom ganzen Lärm der Welt und sehr geeignet, sowohl geistliche als auch schriftliche Früchte hervorzubringen.“. Im Wiener Raum ist diese Klostergründung vermutlich auch der älteste Hinweis auf eine lärmbedingte „Stadtflucht“!
Das Patrozinium des Klosters „Sancta Maria in Paradyso“ spiegelt die besondere Stellung des Paradieses in der Franziskanischen Ordenstradition wieder. Mit dem eingangs zitierten Wunsch des Heiligen Franz von Assisi: „Ich will Euch alle ins Paradies schicken“ soll der Ordensgründer am 2. August 1216 anlässlich der Weihe des kleinen Portiunculakirchleins in Assisi dem versammelten Volk den erstmals von Papst Honorius III. bestätigten vollkommenen, vor allem aber unentgeltlichen Ablass, den jeder reuige Sünder an diesem Tag in der kleinen Kapelle erhalten konnte, verkündet haben. Auch die heute noch über dem Tor der später mit der prächtigen Basilika Santa Maria degli Angeli umbauten kleinen Kirche zu lesenden Worte „Haec est porta vitae aeterna“ (Hier ist der Eingang zum ewigen Leben) weisen auf den durch Reue und Vergebung zu erlangenden Weg ins Paradies hin. In dieser Tradition wird der Portiuncula-Ablass seitdem jährlich am 2. August in jeder Franziskaner- und in jeder katholischen Pfarrkirche gewährt.
Auch die Begräbnisstätte des Heiligen Franz von Assisi weist einen besonderen Paradiesesbezug auf. Nach seinem Tod am 3. Oktober 1226 unweit des Portiuncula-Kirchleins wurde der Ordensgründer seinem Wunsch gemäß auf dem Paradieseshügel, dem „Collis Paradisi“ in Assisi bestattet, heute befindet sich das Grab in der Unterkirche der mächtigen Basilika San Francesco. Ursprünglich hieß der Hügel „Collis Inferni“ (Höllenhügel), da hier die Ausgestoßenen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Verbrecher und Dirnen, bestattet worden waren. Franz erwählte diesen Begräbnisort als Analogie zum Grab Jesu Christi am Berge Golgota, der als Hinrichtungsstätte ebenfalls ein Ort der „Ausgestoßenen“ war.
Schließlich knüpft das Patrozinium des Klosters auf dem Riederberg in der Verbindung des Namens der Gottesmutter Maria mit dem des Paradieses auch an die im Mittelalter besonders durch Bilddarstellungen weit verbreitete Tradition der „Maria im Paradiesgarten“ (hortus conclusus) an. Sie zeigen die unbefleckt - ohne von der Erbsünde belastet zu sein - empfangene Gottesmutter Maria in einem Paradiesesgarten, an dem Ort, wo Adam und Eva, ehe sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, ein „unbeflecktes“ Leben in Verbindung mit Gott geführt hatten.
Im November 1465 vollendete Gabriel Rangone von Verona im Kloster „im Paradies“ das Manuskript einer Predigt-Sammlung mit dem Titel „Flores paradisi“. In diesem heute in drei zeitgenössischen Abschriften bekannten Werk erläuterte er anhand von 42 Predigten die Bedeutung eines gottgerechten Lebens auf dem Weg in das himmlische Paradies. Mit dem Titel „Flores paradisi“ (Paradiesesblüten oder –blumen) verweist der Verfasser auf die Schriftgattung des Florilegiums, der „Blütenlese“ als Auswahl der wichtigsten Stellen aus einem größeren Werk. Auch eine der ältesten Lebensbeschreibungen des Ordensgründers Franz von Assisi ist ein Florilegium mit dem Titel „Fioretti di San Francesco“. Das Attribut „paradisi“ stellt neben dem Hinweis auf das zu erreichende himmlische Paradies auch eine Erinnerung an den Entstehungsort, das Kloster Sancta Maria in Paradyso am Riederberg dar.
Dem paradiesischen Leben im Kloster am Riederberg war jedoch keine lange Dauer beschieden. Erstmals wurde es im Jahre 1509 unterbrochen, als eine große Feuersbrunst die Kirche und Teile der Klostergebäude schwer beschädigten. Und nur zwanzig Jahre später, etwa 65 Jahre nach seiner Gründung, fiel das Kloster Sancta Maria in Paradyso endgültig der Vernichtung anheim! Am 29. September 1529 steckten Osmanische Soldaten, die im Zuge der „1. Wiener Türkenbelagerung“ das Land durchstreiften, die Gebäude in Brand und ermordeten 22 Mönche und Laien. Nur wenigen Brüdern gelang die Flucht in das 3 Stunden entfernt gelegene Neulengbach, wo sie in der Burg Aufnahme fanden. Bei dem im folgenden Jahr 1530 in Langenlois abgehaltenen Provinzkapitel wurde beschlossen, das Kloster Sancta Maria in Paradyso nicht wieder aufzubauen.
Erst ein knappes Jahrhundert nach der Zerstörung des „Paradieses“ wurde in den Jahren 1623-27 in Neulengbach ein neues Franziskanerkloster errichtet. Über dem Eingang der ehemaligen Klosterkirche erinnert heute noch eine Gedenktafel an das untergegangene Vorgängerkloster: „Conventus praesens non est Paradisus ut olim in Sylva dictus …“ - „Der gegenwärtige Konvent ist nicht das Paradies, wie er einst im Walde genannt wurde …“. Doch auch diesem Kloster war kein langes Leben beschieden. Im Jahre 1786 wurde es durch Kaiser Joseph II. aufgehoben.
Die nach dem Brand von 1529 noch stehen gebliebenen Mauerreste des Paradieses am Riederberg hingegen gerieten in Vergessenheit. Auch die zunächst vermutlich wiederaufgebaute Laurentiuskapelle verfiel. Erst in den Dreissigerjahren des 19. Jahrhunderts wurde die verwachsene Ruine von dem Sieghartskirchener Pfarrer Johann Adam Mihm wiederentdeckt. Da allerdings die örtliche Überlieferung außer einigen Sagen von Mönchen mit roten Käppchen und angeblichen verborgenen Schätzen jedoch keine nähere Hinweise zu den Mauern bot, begann Mihm eigene historische Nachforschungen anzustellen. Schließlich konnte er, wie er in der Chronik seiner Pfarre im Jahre 1839 berichtete, die Ruine anhand des bereits erwähnten Werkes von Placidus Herzog aus dem Jahre 1740 identifizieren. Dem erwachenden wissenschaftlichen Interesse seiner Zeit entsprechend untersuchte er die Mauerreste auf das genaueste und fertigte einen Grundrissplan und eine Beschreibung an.
Obwohl die Geschichte der Klosterruine im Paradies immer wieder in historisch-topographischen Veröffentlichungen Erwähnung fand, entzog sie sich durch ihre versteckte Lage weiterhin der allgemeinen Bekanntheit. Für ihren Fortbestand war dieser Umstand ambivalent, denn einerseits verfiel sie immer mehr, andererseits waren auch die Vandalismusschäden geringer, wenngleich die gebrochenen und zum Teil behauenen Steinblöcke sicherlich für die örtliche Bevölkerung ein willkommenes leicht zu gewinnendes Baumaterial darstellten.
In den umliegenden Dörfern bot die romantisch einsam im Wald liegende Ruine auch Anlass zur Entstehung einiger Sagen. Die bereits erwähnten angeblichen Schätze sollen eine arme Mutter mit ihrem kleinen Kind dazu veranlasst haben, am Karfreitag zur Todesstunde Christi in die sich öffnenden Schatzgewölbe hinabzusteigen. Geblendet von Gold und Silber vergaß sie am Rückweg, ihr Kind wieder mitzunehmen. Erst nach einem Jahr konnte sie es am Karfreitag wieder in ihre Arme schließen. Es hatte inzwischen sogar gehen gelernt!
Auch vom benachbarten Klosterbrünndl wird berichtet, dass noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Trockenzeiten der hier wohnende Quellgeist durch Aufrühren des Wassers zornig gemacht werden konnte und die menschlichen Störenfriede mit – zu deren Freude - ausgiebigen Regenfällen „bestraft“ hatte.
In jüngster Zeit ist die Ruine des Klosters Sancta Maria in Paradyso „restauriert“ und damit (vorerst) vor dem weiteren Verfall bewahrt worden, wenngleich der graue Zementmörtel, mit dem die Mauerkronen gefestigt und die Fugen verschmiert wurden, wohl noch viele Jahre der Witterung ausgesetzt sein muss, ehe er eine dem romantischen Ruinenempfinden gemäße Patina angesetzt haben und die Ruine wieder ihren „Alterswert“ erhalten wird.
Und trotz der Nähe zur „Klosterkurve“ der vielbefahrenen Riederbergstraße kann auch heute noch in dem versteckten Waldtal die paradiesische Abgeschiedenheit des Ortes erfahren werden, die Gabriel Rangone von Verona vor 555 Jahren dazu bewogen haben mag, hier das Kloster Sancta Maria in Paradyso zu errichten.
Dieser Text ist ein Auszug aus im Vorbereitung befindlichen Werk: Von der Hohen Schule ins Paradies. Die hier aus Platzgründen weggelassenen Quellenzitate werden dort nachzulesen sein.
Dieter Halama
Geb. 1964 in Wien, Kunsthistoriker, Buchhändler und Antiquar, Buchbinder und –restaurator, wohnt in der historistischen Sommerfrische-„Villa Wiental“ in Pressbaum. Zahlreiche Buchbindeprojekte für Schulen im Rahmen des NÖ Viertelfestivals „Platzhirsch“, Lehrer für Buchbinderei. Kunst- und lokalhistorische Publikationen zu den Themen Sommerfrische, Wienerwald, Habsburg, zuletzt: Portraits der Habsburger von Theodor Mayerhofer (gemeinsam mit Herbert Ascherbauer), Berndorf 2017.
Sarah Iris Mang Zeichnungen
Sarah Iris Mang, lebt und arbeitet in Niederösterreich. Studium an der Akademie der Bildenden Künste und an der Universität Wien, an der Faculdad de Belles Artes in Barcelona. Seit 2008 Unterrichts- und Lehrtätigkeit im Hochschul- und Universitätsbereich. Arbeitet in ihren Kunstprojekten mit unterschiedlichen Medien: Performance, Installation, Film, Zeichnung oder Textilien.