Vincent E. Noel: Von romantischen Schönredereien. Ingrid Reichel
Vincent E. Noel
VON ROMANTISCHEN SCHÖNREDEREIEN
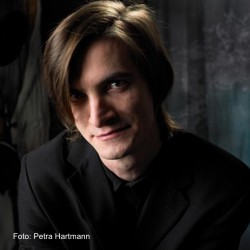 |
Ein kurzer E-Mail Austausch vom 11.11.08 über sein Buch „Opferkind“ zwischen dem Autor Vincent E. Noel und der Redakteurin und Rezensentin Ingrid Reichel.
(etcetera 35/ KIND). Zur Rezension.
Warum spielt Ihre Novelle im Jahre 1905? Und warum in Amboise? gibt es einen triftigen Grund?
Das Jahr ist relativ willkürlich gewählt worden. Ich wollte schon immer etwas Historisches schreiben und habe großes Interesse an der Zeit des Jugendstils. Eine schnelle Zeit, in der viele Entwicklungen zum Abschluss gekommen sind, aber auch Neues entstanden ist – sei es nun in der Wissenschaft, der Geographie oder anderen Gebieten; und vor allem in der Kunst. Hätte ich genügend Geld und würde er noch leben, würde ich mir das ganze Haus von Gustav Klimt ausmalen lassen. Und Amboise zählt zu den schönsten Städten, die ich kenne. Wollte nach der Schule ursprünglich Musiker werden; Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Bin dann zwei Jahre durch Europa gereist, vor allem durch Frankreich. Und in dieser Stadt hatte ich eine sehr schöne Zeit. Dazu die Landschaft der Touraine, nicht umsonst der Garten Frankreichs genannt. Es ist ein Traum. Ich begann eine Liebesgeschichte zu schreiben und Sophie kletterte in das Papier, in die Geschichte hinein; es war ein entsetzlicher Gedanke, dass dieses Mädchen in solch einer traumhaften Stadt lebt, aber nichts sehen kann, so entsetzlich, dass er mir nicht mehr aus dem Kopf kam und in die Tat umgesetzt wurde.
Warum in der Geschichte verweilen, wenn das Thema Gewalt an Kindern doch sehr zeitgemäß und äußerst brisant ist?
Um Klischees zu zerstören. Man hat bei dieser Zeit ein sehr versponnenes Bild vor Augen und redet sich ein, damals wäre noch alles so gewesen, wie es sein sollte: ein jedes Ding hatte seinen Platz, Gottes Ordnung war noch nicht außer Kraft gesetzt. Hach, damals in der guten, alten Zeit. Diese romantische Schönrederei hindert aber daran, sich bewusst zu sein, es gibt Probleme, die nicht der heutigen Zeit entspringen, die ewig sind. Sehnsucht nach einer anderen Zeit ist nichts Gutes in meinen Augen. Gleichzeitig aber ist auch Fakt, der Zeitrahmen des Buches ist unwichtig, es könnte genau so gut 1812 oder 1998 sein beispielsweise. Dies trifft auch auf die Lebensgestaltung zu, auf die damals wie heute so großer Wert gelegt wird, im Sinne von den Gesetzen und Regeln der Gesellschaft. Und so wird die Zeit nicht im Text selber explizit genannt (abgesehen von zwei Stellen, glaube ich), ansonsten nur angedeutet, für den aufmerksamen Leser, mit Formulierungen wie „einem dieser neuartigen Automobile“, hinzu kommt das Schwärmen von Laurence über elektrisches Licht in Paris: „einmal habe ich davon eine Photographie gesehen“ und der Schreibweise der damaligen Zeit: Opiumcigarette, Photographie und so weiter.
Was war ihre Motivation sich mit Kindesmissbrauch zu beschäftigen?
Ehrlich gesagt hatte ich keine, dies hat sich im Verlaufe des Entstehungsprozesses so entwickelt. Gemeint ist damit, ich habe mich nicht hingesetzt und mir gedacht: ich schreibe etwas über Kindesmissbrauch und Drogensucht. Es gab auch keine Vorgabe vom Verlag. Ursprünglich war das Werk als Roman angelegt, es sollte eine Liebesgeschichte sein zwischen Laurence und Adrièn. Dann kletterte Sophie in den Text und noch war alles wunderbar. Als dann aber Marguèrite auch noch ihren Teil vom Glück nach all der langen, dunklen Zeit bekommen sollte, entwickelte Raimond ein Eigenleben und musste alles, alles zerstören. Als ich merkte, als Roman funktioniert der Text nicht, und seitenweise strich, blieb das Thema erhalten, zum Glück, muss man fast sagen, denn es ist zweifellos wichtig, auf derartige Dinge aufmerksam zu machen.
Wer ist Sabine Kosider, der Sie das Buch gewidmet haben?
Die Frau, die ich heiraten werde, sobald ich mir einen Diamantring leisten kann. Den Scherz konnte ich mir nicht verkneifen ... aber im Ernst, sie ist meine Freundin und mein großes Glück, ohne sie bin ich nichts. Vieles Unglück in der Novelle hätte verhindert oder erleichtert werden können, wenn die Menschen miteinander kommunizieren würden. Aber sie tun es nicht, ganz, als ob sie erstarrt wären, sprechen sie nicht miteinander: niemand sieht niemanden an, niemand lächelt niemanden an, niemand redet mit niemandem. Dieser Fehler, diese Schwäche von Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch meine Bücher. Und um mich und sie stets daran zu erinnern, dass wir dies verhindern müssen, diesen Zustand des Schweigens, im gewissen Sinne, war es nur folgerichtig, die Novelle ihr zu widmen. Und, darüber hinaus, ein wunderbarer Weg, ihr und aller Welt meine Liebe zu bezeugen. Wenn ich zum Abschluss noch mich aus einem anderen Text selber zitieren darf: „um gemeinsam mit Dir die Eulen im Stadtpark zu beobachten, die sich keinen Augenblick lang um uns kümmern und deren Schweigen so endlos ist wie meine Liebe zu Dir.“
Kurzbiografie: Vincent Eugen Noel
Geboren 1980 in Guben, lebt in Nürnberg. Schriftsteller und Dramatiker. Mitglied im Theaterlabor. Gründer einer freien Bühne in Nürnberg. Veröffentlicht regelmäßig Kurzgeschichten in einer Tageszeitung, schreibt Novellen, Erzählungen, Theatertexte.
