Wunder: Ausstellung. Rez.: Ingrid Reichel
Ingrid Reichel
Von der Zwietracht zwischen Aberglaube und Wissen
 |
|
|
Albert von Schrenk-Notzing: Das polnische Medium Stanislawa P. mit breitem, fasrigen Ektoplasma, 1913. © Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e. V. Freiburg i. B. |
|
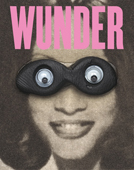 |
Wunder
Kunst, Wissenschaft und Religion vom 4. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Kunsthalle Krems
Pressegespräch: 02.03.1012, 10.30 Uhr
Ausstellung: 04.03. - 01.07.2012
Kurator: Daniel Tyradellis (Praxis für Ausstellung und Theorie)
Wunder
Kunst, Wissenschaft und Religion vom 4. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Hrsg. Daniel Tyradellis, Beate Hentschel, Dirk Luckow
Köln: Snoeck Verlag, 2011. 311 S.
ISBN 978-3-940953-90-2
Preis: 24,80.- Euro
Die Ausstellung Wunder ist eine Koproduktion der Kunsthalle Krems, der Siemens Stiftung und der Deichtorhallen Hamburg, wo vom 23.09.11 bis 05.02.12 bereits die Ausstellung zu sehen war. Da die Kunsthalle Krems kleiner ist, musste die Ausstellung im Konzept und in der Dramaturgie verändert werden. Schwerpunkt in Krems ist die Kunst, während in Hamburg das Wunder in Bezug zur Technik elementarer zur Geltung kam. Viele Objekte sind daher in Krems weggefallen. Dafür wurde ein österreichischer regionaler Bezug mit Werken u.a. von Erwin Wurm, Franz West und Gemälden aus dem der Donau gegenüber liegendem Stift Göttweig hergestellt. Die Ausstellung trägt einen interdisziplinaren Ansatz aus wissenschaftlichen, religiösen und kunsthistorischen Aspekten. Wie schon in der Schau Lebenslust und Totentanz (KH Krems 2010) liefert auch diese Ausstellung kein Gegenkonzept zur Moderne, sondern unterstreicht die Aktualität dieses Themas. So sollen sogar laut einer Umfrage über 50% der Deutschen an Wunder glauben, berichtet der Direktor der Kunsthalle Krems Hans-Peter Wipplinger beim Pressegespräch am Freitag, den 02.03.12. Unter anderem kam es durch die vielen Heilig- aber vor allem Seligsprechungen während des Pontifikats von Johannes Paul II zu einer Renaissance des Glaubens an einem göttlichen Eingriff.
 |
|
|
© Katharina Sieverding: Sonne um Mitternacht schauen, SDO/NASA, 2010. © Foto: Klaus Mettig, VBK, Wien 2012 |
Der Gedanke einer Ausstellung über Wunder kam ursprünglich von der Siemens Stiftung. Über zwei Jahre arbeitete die beauftragte Praxis für Ausstellung und Theorie, an der Realisierung, berichtet der verantwortliche Hauptkurator Daniel Tyradellis. Natürlich legte die Siemens Stiftung Wert auf den technischen Bezug. So war klar, dass für den Kurator das Wunder der Technik als aufgelegte Metapher erschien, Wunder als Schlüsselwort zwischen Transzendenz und abstrakter wissenschaftlicher Denkweise mit der Kunst als Vermittler oder 3. Instanz. So entsteht zwischen den Kunstwerken und den technischen Exponaten eine gegenseitige Befruchtung, die Berührungsängste zwischen Wissenschaft und Kultur zu überwinden helfen soll. Im Glauben an Wunder wird der Wunsch, die Grenzen der Realität zu überschreiten, offensichtlich, meint Tyradellis.
In seiner Einleitung im Katalog bezeichnet Tyradellis Wunder als Öffnung zur Welt, denn dies zeige ihren kleinsten gemeinsamen Nenner. Wunder bieten ein reichlich unübersichtliches Feld. Das Wunder habe seine vermeintliche Unschuld verloren, sinniert Tyradellis, spätestens ab dem Zeitpunkt, in denen trotz wissenschaftlich-technischer Errungenschaften Katastrophen und Unheil nicht abgewendet werden konnten.
Dabei ist es nicht unerheblich zu wissen, dass noch bis vor dem 19. Jahrhundert, Wunder nur im Zusammenhang mit Katastrophen zu sehen waren, als eine Information bzw. Mahnung von Gott an die Menschen, die einen falschen Weg eingeschlagen haben.
 |
|
|
Markus Hofer: Pink Soup, 2011 © Privatsammlung Foto: Alexander Chitsazan |
Um der diffizilen und komplexen Definition des Wunders gerecht zu werden, hat man die Schau in Krems in acht Bereiche gegliedert. So wurde das Wunder in Bezug auf Gemeinschaft und auf neue Errungenschaften, als mediales Ereignis, die Zerrissenheit des Menschen in Ratio und Anima, zwischen fingierter Zauberei und der Sehnsucht nach unbekannten Kräften und Energien, die Zwietracht in den verschiedenen monotheistischen Kulturen um die Bilderverehrung als Glaubensvermittlung oder der kapitalistischen Gesellschaft, die als polytheistisch gilt (Gott des Geldes, Gott des Konsums, Gott des Filmes…), gestellt. Werke von insgesamt 41 Künstler und Künstlerinnen hat man Devotionalien und Votivbilder, Objekte des Alltags (Bsp. Sammlung von Pokémon-Karten; Sammlung von Zustimmungspostakarten zu einem Uri Geller Experiment im Fernsehen der 70er Jahre; Kinder Zauberkasten des Enkels von Goethe, 1830)…), Symbole der Superlative (Helm von Hermann Maier; Szepter der Uni Wien 1558; Taktstock des Dirigenten Daniel Barenboim 2010), Zeugen der Technik (stark deformierter Originalkopf der Brennkammer einer A4/V2 Rakete 1942-45) gegenübergestellt.
Persönliche Hightlights der Ausstellung sind die Flugblätter aus dem 16.-18. Jahrhundert und eine (schändlich!) moderne Kopie auf Leinwand des Turiner Grabtuchs (2006), welches das Stift Göttweig aus Italien erworben hat. Man könnte meinen der Skurrilität sei keine Grenze gesetzt. In einer kleinen Vitrine sind Schluckbilder aus Salzburg und Mariazell (um 1820) präsentiert. Sie sind in der Größe einer Briefmarke und tatsächlich zum Verzehr gedacht gewesen, schützten vor Krankheit und Dämonen, förderten die Gesundheit und die Hoffnung…
So beginnen jene Objekt in Kombination mit den Kunstwerken, selbst zu wahren Schätzen zu werden. Auch scheint das Kunstwerk von der wunderbaren Magie anzuziehen, wie zum Beispiel die "Orgonkiste bei Nacht" (1982) von Martin Kippenberger und Albert Oehlen. Dabei beziehen sich die beiden Künstler auf die von dem Psychiater Wilhelm Reich (1897-1957) entwickelte Orgontherapie, welche durch Orgonenergie - eine primordiale kosmischen Energie - erfolgte. Kippenenweger und Oehlen legten schlechte Bilder in die Kiste, die durch Akkumulation über Nacht in große Meisterwerke verwandelt werden. Es ist direkt ein Wunder, dass die 1982 entwickelte Kiste nicht zum Topprodukt avanciert ist!
 |
|
|
© Helmut & Johanna Kandl: Gospa (Medjugorje) aus: O Maria Hilf, 2011 |
Hervorzuheben ist der Anteil zahlreicher Videos von Künstlern, die im Großteil als Dokumentationen zu bewerten sind und nur durch ihren Zusammenschnitt und ihre Präsentation als Kunst interpretiert werden können. Sie tragen in dieser Vorführung von Wundern zum entscheidenden emotionalen Faktor bei. Als Beispiel allen voran: Helmut und Johanna Kandler mit ihrem imposanten 15 minütigen Video "O Maria Hilf", das auf vier Leinwänden synchron verschiedene Aspekte zum katholischen Wunderglauben zeigt, nämlich der Wahlfahrt, der Verzückung, der Hoffnung und des lukrativen Geschäfts mit Devotionalien.
Die Ausstellung ist völlig wertfrei und parteilos gestaltet und strebt einen dokumentarischen Charakter an, der den Zwiespalt zwischen der Rationalität und der Irrationalität aufzeigt. Auch der umfassende und ansprechende Katalog zur Ausstellung bleibt dieser Strategie treu. Durch die ausgezeichneten Essays vermittelt sie einen noch profunderen Hintergrund zum Thema Wunder. So befasst sich z.B. der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman in seinem Artikel mit dem Gebrauch und Missbrauch der Wunder und der Wiener Philosoph Robert Pfaller entlarvt in seinen Gedanken über "Die Erschwernisse des Staunens" die Hochkonjunktur der Wunder als Krisensymptom. Einziger Kritikpunkt zum Katalog sind die fehlenden biografischen Daten der Autoren, die in einer Neuauflage unbedingt ergänzt werden sollten.
Letztendlich bleibt es dem Besucher und Leser überlassen, sich eine Meinung über Wunder zu bilden. Die Balance zwischen Ehrfurcht und Unverständnis gegenüber dem Gezeigten macht die sonderbare Mischung aus, die Geist und Witz verströmt und den Besucher beschwingt die Kunsthalle verlassen lässt.
Eine ergiebige Ausstellung für die man sich Zeit nehmen sollte, um auch die Informationen zu den jeweiligen Werken und Schaustücken zu lesen.
Desweiteren begleitet ein umfangreiches Programm die Ausstellung. So war noch vor der offiziellen Ausstellungseröffnung die Künstlerin und Friedensaktivisten Yoko Ono, der Tags zuvor am 01.03.2012 in Wien der Oskar-Kokoschka-Preis für ihr künstlerisches Gesamtwerk überreicht wurde, am Freitag Abend vor der Ausstellungseröffnung bei einer Benefizpreview in der Kunsthalle Krems mit einer Performance zu sehen. Am Freitag, den 20. April findet eine Podiumsdiskussion mit dem Philosophen Meinhard Rauchensteiner, dem ehemaligen Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich Anas Schakfeh, dem Kunsthistoriker Gustav Schörghofer und dem Kurator der Ausstellung Daniel Tyradellis statt. Am Freitag, den 11. Mai findet eine Lesung über das Wunder der Literatur aus Werken u.a. von Kurt Tucholskys "Lourdes" und Max Frischs "Homo Faber" statt. Parallel zur Ausstellung zeigt das Kino Kesselhaus (www.kinoimkesselhaus.at) das Wunder aus der Perspektive des Films. Auch wurde im Programm auf die Jüngsten der Besucher nicht vergessen.
Mehr unter: www.kunsthalle.at/kunsthalle-krems/veranstaltungen/aktuell
